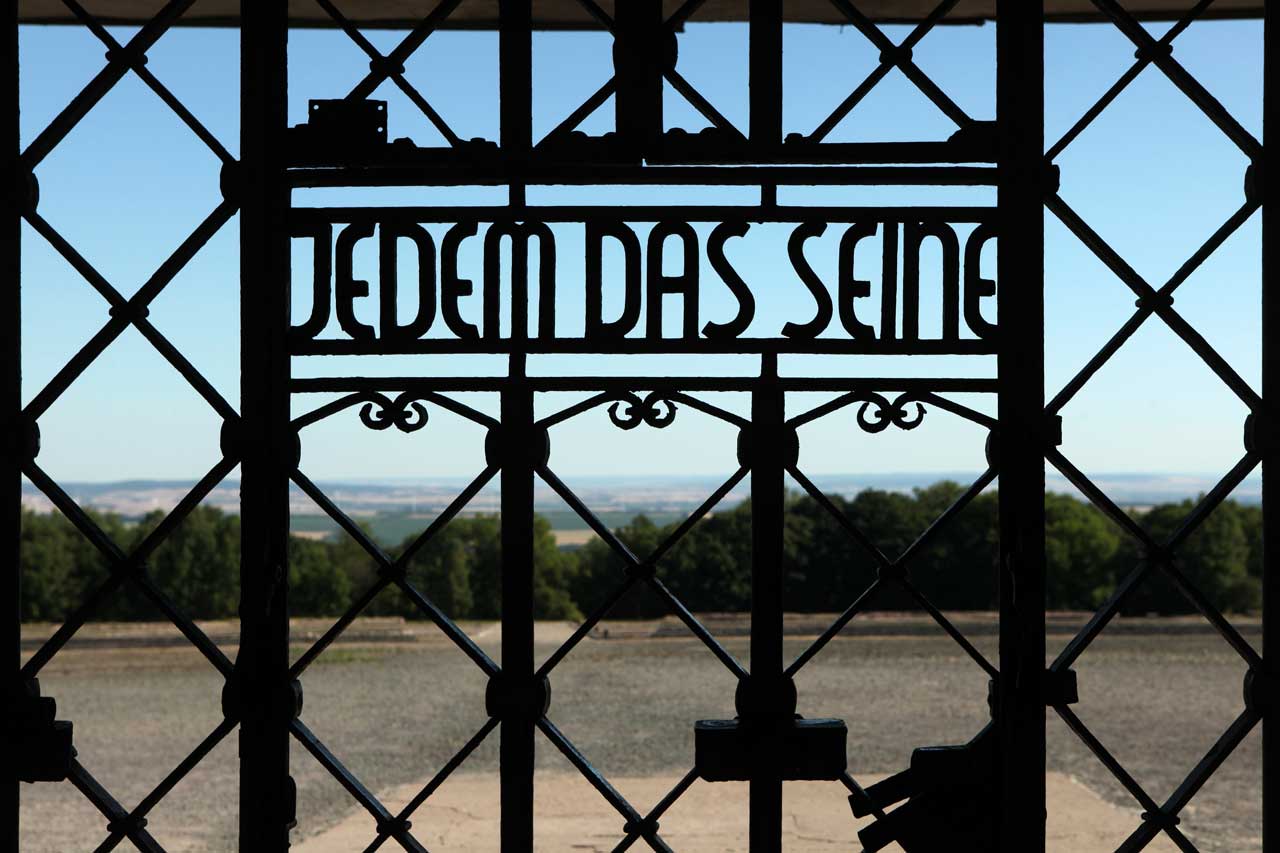In Deutschland gibt es nur noch wenige Menschen, die den Nazi-Schrecken am eigenen Leib erlebt haben. Holocaust-Überlebende haben in den vergangenen Jahren dafür gesorgt, dass an die Massenvernichtung von Menschen erinnert wird. Jens-Christian Wagner, Historiker an der Uni Jena, hat früher verschiedene Gedenkstätten geführt. Im Interview geht es um die Frage, wie die Aufarbeitung des Nationalsozialismus funktionieren kann, nachdem die Zeitzeugen nun alle nacheinander sterben.
Holocaust-Gedenken: Die Opfer des Nationalsozialismus
Herr Wagner, die Generation der Zeitzeugen des Nationalsozialismus stirbt gerade. Was macht das mit unserer Erinnerung an diese Zeit?
Jens-Christian Wagner: Insgesamt spielt der Abschied von den Zeitgenossen in der Praxis der Gedenkstättenarbeit nicht die Rolle, die ihr manchmal zugeschrieben wird. Auch vor zehn oder 20 Jahren haben 99,9 Prozent aller Besucherinnen und Besucher einer Gedenkstätte dort keine Überlebenden angetroffen.
Natürlich gibt es das Format des Zeitzeugengesprächs, insbesondere bei Gedenktagen oder in Schulen. Aber eine größere Rolle für die wissenschaftliche Aufarbeitung als die Überlebenden selbst, spielen ihre Berichte. Und die sind umso wertvoller, je zeitlich dichter am historischen Geschehen sie abgegeben wurden. Denn nach langer Zeit kann man vielfach nicht mehr unterscheiden, was man selbst erlebt oder gelesen oder von anderen gehört hat. Menschliche Erinnerung ist nun einmal nicht exakt.
Das Nazi-Regime hat diesen Menschen nämlich Integrationsangebote gemacht, die bereitwillig angenommen wurden. Das emotionale Angebot, dazuzugehören zum Beispiel, dieses Wechselspiel zwischen „Die“ und „Wir“.
Oder Kriminalisierungsdiskurse: Man erzählte, dass KZ-Häftlinge gefährliche Verbrecher seien. Oder Verheißungen der Ungleichheit: Den Deutschen wurde erzählt, es gehe ihnen besser, wenn es anderen, etwa den Juden oder den Zwangsarbeitern, schlechter geht. Das hatte subjektive Aufstiegserfahrungen zur Folge. Die Arbeiter, die vorher in der Hierarchie ganz unten standen, hatten in den Zwangsarbeitern plötzlich jemanden, der noch weiter unten stand.
Rassismus, Antisemitismus und autoritäres Denken spielte bei all dem auch eine Rolle.
Gibt es dabei auch etwas für das Heute zu lernen?
Jens-Christian Wagner: Wenn man sich die genannten Faktoren anschaut - insbesondere die Verheißungen von Ungleichheit, die Kriminalisierungsdiskurse in Bezug auf Ausgegrenzte oder autoritäres Denken - dann stellt man fest, dass das gar nicht genuin nationalsozialistisch ist. Diese Faktoren entfalten auch heute ihre Wirkung.
Man denke an die AfD. Hier könnten wir Aktualitätsbezüge jenseits falscher historischer Analogien herstellen. Das wäre aus meiner Sicht effektiver, als mit dem erhobenen Zeigefinger zu kommen und zu sagen „Erinnert euch!“.