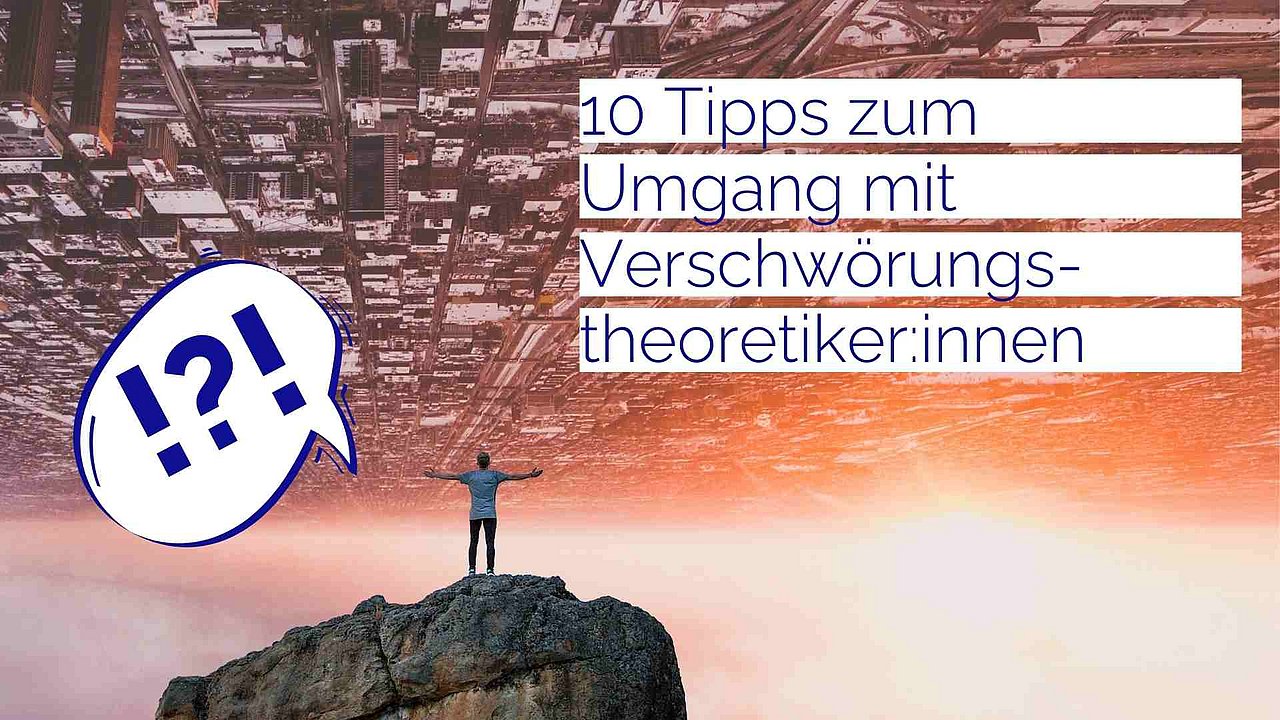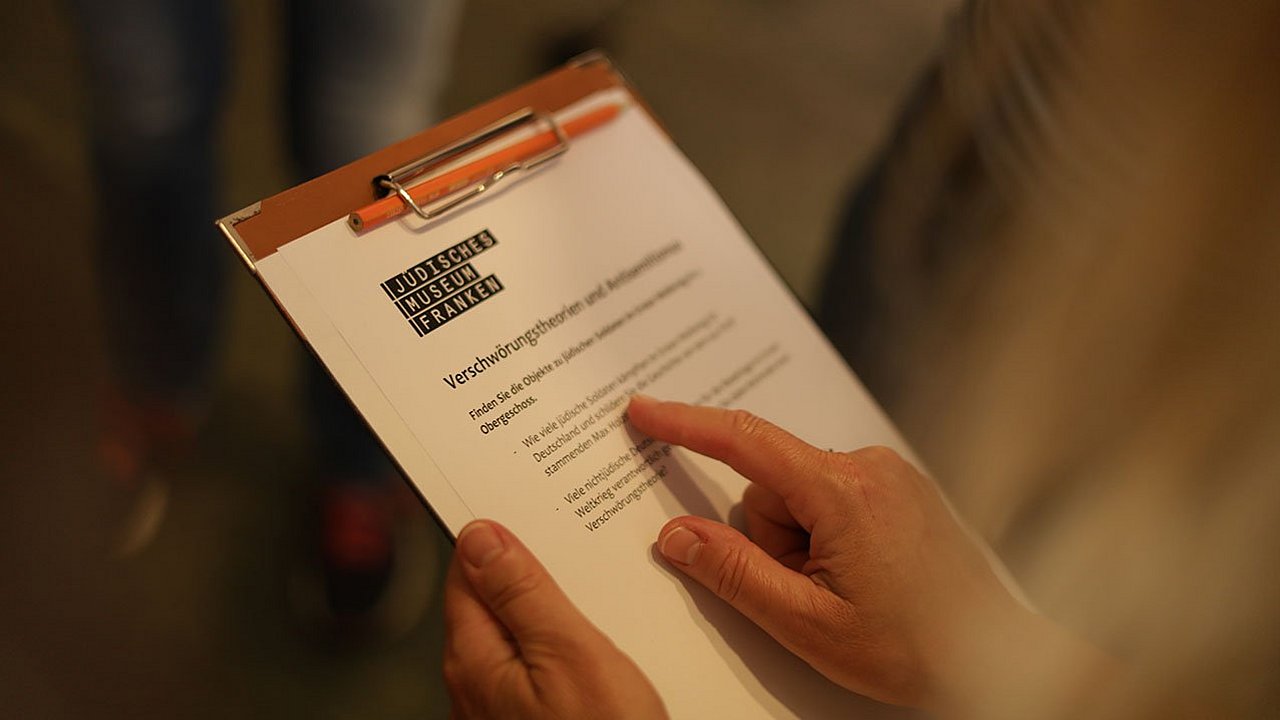Bewusste Desinformationen, krude Verschwörungstheorien oder Extremismus: In Deutschland gibt es eine verschwörungsideologische Szene. Das zeigt sich beispielsweise deutlich im russischen Angriffskrieg oder im „Reichsbürger“-Milleu. Und manchmal werden die unglaublichen und angeblichen Wahrheiten in Famiilie und Gesellschaft als Spinnerei abgetan.
Was steckt hinter Verschwörungsglaube?
Gründe für Verschwörungsglauben
Manche Menschen scheinen anfälliger für solche Erzählungen, Mythen und Ideologien als andere. Warum das so ist, versucht Felicitas Flade zu erklären. Sie ist Sozialpsychologin an der Uni Mainz. Sie nennt mehrere Gründe:
- „Verschwörungsgläubige wollen sich einzigartig fühlen.“
Solche Menschen neigten zu Minderheitenpositionen. Klar ist: Ob jemand überall geheime Machenschaften wittert, hat nichts mit dessen Intelligenz oder mit psychischen Krankheiten zu tun. Aber es gebe bestimmte Menschen, die anfälliger dafür seien. „Dominanzorientierte Leute zum Beispiel, die eine stark hierarchische Gesellschaft bevorzugen“, zählt sie auf, „oder Rechtsautoritäre.“
- „Der typische Verschwörungsmystiker hält sich für schlauer als andere.“
Bei nahezu allen Verschwörungserzählungen fällt auf, dass sie mit einer starken Selbstaufwertung und einer Abwertung anderer Menschen verbunden sind. „Schlafschafe“ ist ein beliebter Ausdruck in der Szene für alle, die sich von der sogenannten Propaganda einlullen lassen. Insofern liegt die Vermutung nahe, dass Verschwörungsglaube viel mit einem geringen Selbstwertgefühl zu tun hat. Ein solcher Zusammenhang sei plausibel, bestätigt Flade, allerdings sei er von der Forschung nicht sicher belegt.
- Das Gefühl, Kontrolle über das eigene Leben zu haben, spielt auch eine Rolle.
Menschen, bei denen dieses Gefühl nur gering ausgeprägt ist, seien anfällig für Kontrollillusionen. Die Überzeugung, ein fieses Spiel aufgedeckt zu haben, kann so eine Illusion sein.